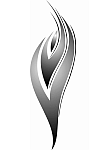Aus den Altenburger Pestjahren
In den Rechnungen der Hospitäler der Stadt Altenburg finden sich Spuren, die von den schweren Jahren der Pest im 16. Jahrhundert künden. Sie berichten von den Ausgaben für Särge und Totengräber, für Spitäler und Prediger und auch von jenen seltsamen Mitteln, die man zur Heilung oder Vorbeugung zu beschaffen suchte. Unter diesen Mitteln ragt eines hervor: das sogenannte Goldene Ei.
Die Stadt selbst war in jenen Tagen kaum wiederzuerkennen. Die Gassen lagen still, viele Häuser waren verschlossen, ihre Bewohner dahingerafft oder geflohen. Die Märkte standen leer und nur das Totenläuten und das Knarren der Karren, die die Pestopfer hinaus vor die Mauern brachten, hallten durch die Straßen.
In dieser Lage wandte sich der Rat an die Diakonen, die als Fürsorger über Arme und Kranke wachten. Diese wiederum suchten die Apotheken auf und ließen nach Rezepturen forschen, die von Gelehrten wie Wirsung und Thal überliefert waren. Beide nannten in ihren Schriften das Goldene Ei, wenn auch in unterschiedlicher Anwendung: der eine zur Förderung des Schweißes bei Ansteckung, der andere zur Prophylaxe.
Die Zubereitung war beschwerlich und kostbar. Ein Ei wurde geöffnet, das Eiweiß entfernt, das Eigelb mit Safran vermischt – jenem roten Gewürz, das mehr wert war als Gold. Die Schale wurde verschlossen, das Ei in der Glut gebraten, bis es dunkel und hart war. Danach zerstieß man das Innere und vermischte es mit Senfsamen, Diptam, Blutwurz und Angelika, mit Zitwer, Kampfer und Bibernellen, auch mit dem vielgerühmten Allheilmittel Theriak und schließlich mit rotem Wein.
So entstand eine Latwerge, bitter und schwer, die in kleinen Portionen gereicht wurde. Manche nahmen sie, um der Krankheit zuvorzukommen, andere erhielten sie, als das Fieber sie bereits ergriffen hatte. Und obgleich niemand sicher sagen konnte, ob das Goldene Ei mehr als Hoffnung sei, findet sich doch in den Rechnungen mancher Diakonatskasse der Vermerk über die Anschaffung desselben – ein Zeichen dafür, dass es als kostbar und wirksam galt.
Die Altenburger Bürger sahen im Goldenen Ei nicht allein ein Medikament, sondern auch ein Sinnbild ihrer Not. Es stand zwischen Heilkunst und Aberglauben, zwischen Glaube und Verzweiflung. Denn Safran, Hauptbestandteil des Mittels, konnte Lunge und Magen beruhigen, zugleich aber die Kranken in Gefahr bringen, wenn sie zu viel davon nahmen.
In Anlehnung an:
Julia Mandry: Die Pest in Altenburg im Spiegel von Kastenrechnungen der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
Zeitschrift für Thüringische Geschichte, Band 70 (2016)
Herausgeber: Verein für Thüringische Geschichte, Historische Kommission für Thüringen